Zur
offiziellen Hauptseite
unserer Burschenschaft





.

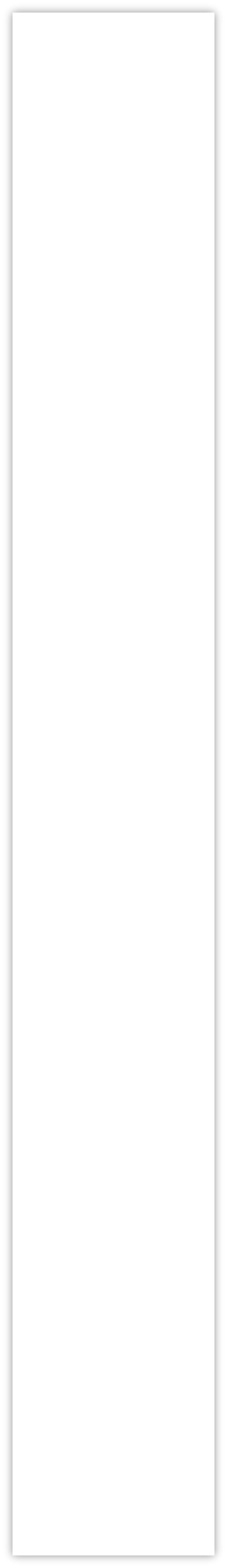
N U N Q U A M R E T R O R S U M !

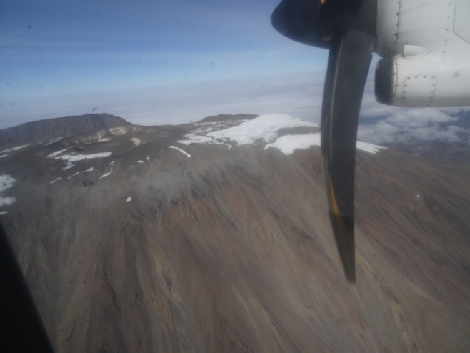











































Rugierfarben auf dem Kilimanjaro
Jan 2016
Prolog
Da war die Idee.
In ihrem Ursprung jedoch zwischenzeitlich fast vergessen.
Der Samen für unsere Unternehmung wurde vor mehr als 15 Jahren gelegt, als ich als Gast einer fulminanten Geburtstagsfeier zu einem 30-
Minuten intensiven Informationsaustausches später begann ich zu erfassen, daß es zwar eine extrem anstrengende Sache ist, die auch nicht jeder zu Ende bringt, es allerdings nichts mit Bergsteigen, Sicherheitsseilen, Eispickeln o.ä. zu tun hätte. Mehr so eine Art beschwerliche Wanderung war. Es also eigentlich jeder, ohne besondere Vorbildung bewältigen könne.
Unglaubwürdigerweise behauptete er auch noch, nicht wirklich sportlich zu sein.
So fern ab seine Geschichte von meinen eigenen Ambitionen zu diesem Zeitpunkt war, so nachhaltig beeindruckte mich seine so lang anhaltende Begeisterung, die Endorphine, die noch nach Wochen in seinem Blut rauschten.
Sommer 2014. Zu Sechst sitzen wir in einer Maschine auf dem Weg von Nairobi nach Moshi (Tanzania). Uns erwarten 2 Wochen Rundreise durch's Land. Von Lodge zu Lodge mit einem Jeep unterwegs, wollen wir mehrere Naturparks besuchen und einen klassischen Safari-
Bereits im Sinkflug, macht uns der Kapitän darauf aufmerksam, daß wir Rechts neben uns den Kilimanjaro sehen können und er extra für uns eine kleine Runde macht. Also mehr einen kleinen Knick.
Mit der diffusen Erinnerung an die damalige Entzauberung des Mythos überkommt mich ein Hauch von Größenwahn und ich stoße meinen supersportlichen, Triatlon – und Maraton erfahrenen Bbr.Jens an und sage: da will ich auch noch mal rauf. Worauf er mir den erhofften entgeisterten Blick zu wirft und dann abwehrend den Kopf schüttelt. Das wäre nicht sein Ding.
Aber ich solle mir das auch noch überlegen. Er platziert seine Worte sehr bewußt und fährt fort: seiner Meinung nach, müsse ich da vorher auch noch einiges tun. Okay. Das hat er ja noch nett gesagt.
April 2015. Volkmar, ein damals noch eher entfernter, mir jedoch sehr sympathischer Freund, hält einen Vortrag über seine Kilimajaro-
Januar 2016. Diesmal sitzen wir zu Dritt im Flieger im Anflug auf den Kilimajaro-
Wir bekennen uns einstimmig zu einer gewissen inneren Spannung mit Blick auf das, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe außerdem noch Momente, wo ich mich fühle, als würde ich freiwillig russisches Roulette spielen.
Meine beiden Mitreisenden haben erheblichen Anteil an unser Vorbereitung auf diese Unternehmung. Beide sind erfahrene Ausdauersportler die wissen, wie wichtig die optimale körperliche, technische aber auch mentale Vorbereitung auf solche Höchstleistungen ist. Wir sind echte Flachlandindianer, kennen Berge nur vom Skifahren, und keiner von uns war je oberhalb von mehr als 3800m unterwegs. Jetzt wollen wir auf fast 6000m. Ab 5000m spricht man in der Literatur schon von der „Todeszone“, in der ein längeres Überleben auch für Trainierte nicht möglich ist.
Sie haben mit einer ganzen Reihe von Kili-
Die Empfehlung unseres Reiseveranstalters ist es zuvor 5x pro Woche ca. 1h Ausdauersport zu machen, ein halbes Jahr lang.
Ja, Entschuldigung. Das sind zusammen mit Vor-
Dank Jens, der sich besser auf meine marrotige Unsportlichkeit eingestellt hat, als jeder Sportlehrer den ich je hatte, finden wir ein Training für mich, das wenig Zeit kostet und trotzdem schnell den jämmerlichen Zustand meines Herz-
Jeden Morgen 10 min diverse Übungen in maximal erreichbarer Schnelligkeit und Dichte, nur mit winzigen Pausen (Steigerungsmöglichkeit: in diesen Pausen die Luft anhalten !), bis mir die Zunge heraushängt, das Herz versucht durch den Hals zu entkommen und der Schweiß aus den Poren spritzt. Jeden Tag.
Als gefühlt „schwächstes Glied“ unserer Gruppe mache ich mir natürlich noch weit mehr Gedanken, wie ich das Trainingsdefizit ausgleichen kann. Der Satz von Volkmar läßt mich im Sommer 2015 ein Pulsoxymeter kaufen. Eine Eingebung. 30 € für eine Fingerklemme mit Display, die die Pulsfrequenz und die Sauerstoffsättigung anzeigt. Auch für Laien problemlos zu verstehen. Und so trifft es sich gut mit einem Geschenk zu meinem 50.Geburtstag, daß ich mit einem Gutschein in der einen Hand und dem Pulsoxymeter in der anderen im Hotel Bornmühle bei Neubrandenburg vor dem Fitnessraum stehe und eine Stunde „Höhentraining“ in Anspruch nehme.
 Der Sauerstoffgehalt der Luft wird auf das Niveau von Bergluft abgesenkt. Ein Display an der Wand zeigt die vergleichbare Höhe an. Schon das erste Experimentieren damit bringt Erstaunliches zu Tage: Ab 2500m sinkt die Sauerstoffsättigung des Blutes erheblich ab. Während man auf Höhe Meeresspiegel kaum eine Chance hat, seine Sauerstoffsättigung auf unter 90 % zu senken (trotz Luftanhalten bis fast zum Umfallen !) ist man auf 3500m ganz schnell bei 80% -
Der Sauerstoffgehalt der Luft wird auf das Niveau von Bergluft abgesenkt. Ein Display an der Wand zeigt die vergleichbare Höhe an. Schon das erste Experimentieren damit bringt Erstaunliches zu Tage: Ab 2500m sinkt die Sauerstoffsättigung des Blutes erheblich ab. Während man auf Höhe Meeresspiegel kaum eine Chance hat, seine Sauerstoffsättigung auf unter 90 % zu senken (trotz Luftanhalten bis fast zum Umfallen !) ist man auf 3500m ganz schnell bei 80% -
So verwunderlich ist das natürlich nicht: das CO2 wird genauso abgeatmet, wie vorher. Und nur das ist es, was uns in ansteigender Konzentration sonst das Gefühl von Luftnot vermittelt. Haben wir mal in Physiologie gelernt.
Mit dem Verpressen der Ausatemluft läßt sich der Partialdruck des Sauerstoffes jedoch deutlich erhöhen. So machen es die Apnoetaucher, wenn sie versuchen ihren Körper vorm Abtauchen noch einmal maximal mit Sauerstoff zu beladen.
Oder, wie es mir später jemand erklärt, es Asthmatikern gelehrt wird. Dort heisst es „dosierte Lippenbremse“. Genaugenommen also nichts Neues. Kombiniert mit einer hohen Atemfrequenz presst man so erheblich mehr Sauerstoffmolekühle ins Blut.
Das habe ich mir doch die ganze Zeit schon überlegt und es klappt. („Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.“)
Sobald ich tief und schnell atme und ausserdem beim Ausatmen durch den Mund die Lippen zusammenpresse, schaffe ich es bei zuletzt 4100m meine O2-
Das Wochenende vor der Abfahrt trainieren wir noch mehrmals gemeinsam. Und wir testen die Möglichkeiten dieser Atemtechnik ausführlich aus und sind von der Effizienz begeistert. Nachahmung wärmstens empfohlen !
Vorm Flughafen wartet mit einem Schild in der Hand ein sympathisch lächelnder Schwarzafrikaner auf uns. Wilson -
Wir haben bei der Buchung um einen deutschprechenden Guide gebeten und etwas mehr dafür bezahlt. Eine lohnende Investition, da uns so viel komplexere Gespräche möglich sind und wir sehr viel Zeit miteinander verbringen werden. Dass es zudem so ein netter Kerl ist – ein Hauptgewinn !
Inzwischen ist es spät Abends und wir werden ohne Abendessen auf unsere Zimmer gebracht.
Zum Glück haben wir einen Berg Snacks dabei, so daß wir nicht hungrig einschlafen müssen.
Den nächsten Tag (0) nutzen wir, um uns in Moshi umzuschauen und uns lokale SIM-
Am nächsten Morgen (Tag 1) geht es früh los.
Wir haben unser Gepäck getrennt. Jeder hat einen kleinen 30-
Die Kleidung für den Rückflug und alles andere Entbehrliche bleibt in den großen Reisetaschen, mit kleinen Vorhängeschlössern verschlossen, in einer Aufbewahrungskammer des Hotels zurück.
Am Büro des Veranstalters steigen wir in einen kleinen Bus, in dem schon unsere gesamte Truppe sitzt. Je Reisenden sind 3 Träger, „Porter“ engagiert, außerdem ein Koch: Musa und ein Kellner: Ibrahim. Wir staunen nicht schlecht. So genau wußten wir das vorher nicht. Und Wilson hat noch einen Assistent-
Wilson hat mit allen schon mehrmals zusammengearbeitet und erklärt uns stolz, daß er sehr zufrieden ist mit seiner Mannschaft.
Unser Ziel ist zunächst das Londorossi-
Bis zum Lemosho-
Auf einer moddrigen Lichtung im Dschungel werden wir entladen. Wer sein Paket auf den Rücken bekommen hat, beginnt mit zügigen Schritten den Aufstieg. Wilson hat zwei etwas leichter beladene Männer mit den Zelten vorweg geschickt, um uns einen schönen Platz am Rand des Camps für unsere erste Übernachtung zu sichern. So ein Cleverle.
In meinem Rucksack stecken fast 9kg, wie ich mit unserer winzigen Reisewaage überprüft habe, von allem noch etwas extra, „wegen der Sicherheit“ -
Der Weg ist zwar befestigt (querliegende Holzstangen, z.T. Geländer) aber auch reichlich matschig. Die superleichten Trekkingstöcke und die Gamaschen habe ich heute zwar wirklich nur der Sicherheit halber mitgenommen. Nach mehreren Metern ist meine Hose aber schon beschmiert, und mehrmals wäre ich fast ausgerutscht. So hole ich beides doch bald heraus und werde es die ganzen Tage über benutzen.
Nach 4 Stunden und ca.10 km erreichen wir auf 2750m das Mti Mkubwa-
Unsere Handy haben kein Netz. Wir klemmen eins an einen meiner Akku-
Volkmar hatte dramatische Beschreibungen von den Toiletten der Coca-
Allerdings sehen unsere Toiletten bei weitem nicht so schlimm aus, wie befürchtet.
Gegen 22:00 sind es noch 25 Grad Celsius. Mein Military-
Tag 2: Nach dem Frühstück um 7:00 marschieren wir um 7:30 ab. Alles haben wir schon vorher wieder auf Ruck-
12km in 7h sind angesagt.
Nach etwa 4h erreichen wir ein Camp, Shira 1 und ich freue mich schon. Aber es geht weiter. Unser Ziel ist das Shira 2 Camp auf 3800m.
Angeblich sagt man hier am Kili immer „Pole pole“, was heisst: immer schön langsam. Aber ich bin mit Sportlern unterwegs und Wilson treibt uns auch eher an, so gehen wir zügigen Schrittes auf der fast waagerechten Shira-
Als wir nach einem 9h Gewaltmarsch ankommen, resümiere ich eine neue körperliche Höchstleistung. Die 30km-
Andere, die auf dem gleichen Weg unterwegs waren, trudeln erst nach 12h Stunden bei Dunkelheit im Camp ein. Inzwischen haben wir uns erholt, gewaschen, gegessen, die den Hang heraufwehenden Wolkenfetzen im Sonnenuntergang beobachtet und fotografiert und tiefenentspannt festgestellt, daß es nahezu unbegreiflich ist, daß wir vor einer Woche noch, um diese Zeit gerade aus unseren Praxen nach Hause gekommen sind. Und daß wir heute alles richtig gemacht haben.
Irgendwer läßt in der untergehenden Sonne eine Drohne über das Lager fliegen. Ein Geräusch, das mehr Zivilisation vermittelt, als hierher gehört. Obwohl: die Fotos hätte ich gern.
Wir beschließen den Abend mit einer gemeinsamen Pulsoxymetermessung. Wilson, der gerade dazu kommt, schlägt uns aus dem Stand mit 94 % und lächelt zufrieden. Wir drei stehen -
Immer wenn ich nachts wach werde, mache ich eine hektische Pressatmungsrunde, da die Messwerte beim entspannten Nachtschlaf noch weiter abfallen. Sobald sich ein leichter Druck im Hinterkopf aufbaut, kann ich ihn auf diese Weise, mit einem Verzug von mehreren Minuten reduzieren.
Morgens wache ich auf und freue mich, daß ich keinerlei Kopfschmerzen o.ä. verspüre.
Tag 3: Wecken um 7:00, Frühstück um 8:00. Bis dahin haben wir unsere Sachen schon wieder zurecht gepackt. Jens zeigt stolz ein Foto, daß er in der Nacht vom Kili gemacht hat: Bei klarem Himmel und Mondschein -
Ziel der Lemosho-
Unser Weg ist ein einziges Auf und Ab, durch und über die dauernieselregenbedingt überall vorbeiplätschernden Rinnsale. Wir wandern durch Wolkenfetzen. Mehrmals stehen wir auf Hügelspitzen, blicken in die uns umschließende graue Wand und lassen uns von Wilson ausführlich den überwältigenden Ausblick erklären -
Unsere winterweiße, europäische Haut hat ihr nicht viel entgegenzusetzen.
Die allgemeine Enttäuschung kann ich nicht ganz teilen, da ich mir kaum wage vorzustellen, was für eine Schinderei es für mich wäre, diese Strecke bei wolkenfreiem Himmel zu bewältigen.
Das kleine Quantum Sonne läßt ahnen, wie warm es hier werden kann.
Außerdem ist mir das wirklich egal, wenn wir nur auf dem Gipfel klares Wetter haben.
Als wir auf der Ebene des Lava-
Das verbessert die aufgekommene wetterschlechte Laune nur minimal.
Als wir am anderen Ende das Plateaus angekommen sind, beginnt ohne die versprochene, herausragende Aussicht, schon wieder der Abstieg über einen steilen, scharfkantigen Pfad, den entlang munter das Regenwasser plätschert. Wir hocken uns dicht an eine überhängende Felswand und verspeisen hastig unser Mittag. Irgendwann reisst die Wolkendecke auf und wir erahnen zurückblickend, was uns entgangen ist.
Das Barranco-
Soviel stille Autorität und Durchsetzungsvermögen hätten wir unserem immerfreundlichen Wilson nicht zugetraut.
Als es Nacht wird, reißt wieder der Himmel auf und gibt den Blick auf den Kili frei. Zeit für Fotos.
Tag 4: Am Morgen ist die Sicht trotz Bewölkung zumindest deutlich besser, als am Tag zuvor.
Vor uns liegt der Mythos „Breakfast-
Da in diesem Camp auch die Machame-
Schon rein optisch etwas fürs Herzklopfen.
Eingereiht in die Karawane müssen wir dann aber feststellen, daß es immer wieder zu längeren Pausen an Engpässen kommt, da sich zwischen bestimmten Felsblöcken Personen nur einzeln hindurchzwängen können. Zeit den Rucksack abzuwerfen und sich zu setzen. Als wir oben ankommen, habe ich auf Grund der vielen Pausen das Gefühl das leichteste und entspannendste Stück der ganzen Tour hinter mir zu haben. Auch hier endet der versprochene „tolle Ausblick“ in Wolkenfetzen, die nur wenige Meter vor unseren Augen vorbeitreiben.
Danach geht es noch mehrmals Auf und Ab, bis wir gegen 13:00 das Karanga-
Andere müssen das Problem auch gehabt haben. Die Fläche ist überseht mit Steintürmchen der Langeweile.
Erst als wir resigniert beschließen abzusteigen, reisst das Wolkenband auf und gibt den Blick auf den Berg und für Fotos frei.
Als wir im Camp ankommen, ist der Himmel völlig klar und über dem Berg geht vor klarem Himmel der Vollmond auf. Das wäre nach dem Regenwetter natürlich der verdiente Hauptgewinn!
Wie in den Nächten zuvor, sortiere ich auf dem Smartphone die besten Fotos heraus und sende sie an meine Dropbox -
Mein Solarladegerät ist auf Grund des permanent bedeckten Himmels leider geradezu unbrauchbar.
Zum Glück habe ich 3 große Akkupacks dabei, die meinen bzw. unseren Strombedarf, inklusive täglich-
Tag 5: Der Morgen weckt uns mit viel Licht. Die Wärme treibt uns aus den Zelten. Die Gelegenheit ist günstig, deshalb positioniere ich meinen Solarlader und erfreue mich am blinkenden Lämpchen am Akkupack. Geht doch ! Bringt am Ende aber auch nicht überragend viel.
Unseren Leistungsbedarf könnten wir damit nicht decken.
Der Tag beginnt gelassen. Wir haben nur wenig Strecke vor uns bis zum Barrafu-
Zeit zum Kräftesammeln für die entscheidene Etappe…
An einem kleinen Wasserlauf unterhalb des Karanga-
Wir sortieren sorgfältig unserer Equipment für die Nacht, den Höhepunkt der Reise. Meinen Rucksack mache ich erst einmal völlig leer und befülle ihn dann sehr zurückhaltend. Nichts mehr „Extra“. Ich feilsche mit mir um jedes Gramm.
Und pokere: Das 500g Regencape bleibt im Zelt. Regnen darf es jetzt also nicht mehr. Am Ende habe ich gerade einmal 3kg. Nach der Schlepperei der letzten Tage sind die fast nicht zu merken.
Das warme Abendbrot und die abendliche Filmguckerei sorgen schließlich für eine gewisse Entspannung, obwohl der Wind hartnäckig am Zelt reißt und es bitter kalt wird. Jens und Inez haben festgestellt, daß der Empfang gerade recht gut ist und machen eine ausführliche Whatsapp-
In dieser Nacht spielen mein Hohlfaser-
Dank der regelmäßigen „Sauerstoffduschen“ unserer Atemtechnik fühlen wir uns jedenfalls recht wohl. Null-
Um 23 Uhr weckt uns Wilson. Es gibt eine letzte „Henkersmahlzeit“. Unsere Zelte können wir ausnahmsweise so zurücklassen. Ein letztes Sortieren, die Stirnlampe an und dann geht es einige Minuten vor Mitternacht in langsamen, gleichmäßigen Schritten los.
Tag 6.
Wir sind in Zwiebelschalen-
Der Vollmond, auf den wir uns schon gefreut hatten, leuchtet wohl gerade auf der anderen Seite des Planeten. Wir haben zwar sternenklaren Himmel, trotzdem ist es so dunkel, daß wir ohne unsere Stirnleuchten aufgeschmissen wären. Allein der Schattenriss des Kraterrandes ist vor dem Sternenhimmel gerade so zu erkennen und bleibt über Stunden völlig unverändert über uns. Irgendwo auf der Mitte der Strecke rechne ich mir aus, daß die 1400m Höhenunterschied, an denen wir gerade knabbern, einem Hochhaus mit etwa 500 Stockwerken entsprechen, die wir die quasi im Treppenhaus bewältigen. Und zudem so blöd sind erst bei 4600 m Höhe loszumarschieren. Die offenkundige Absurdität dieses Vorhabens läßt meine Motivation gefährlich bröckeln und ich beschließe schnell mir statt dessen Gedanken zu machen, mit welchen „ersten Worten“ ich das Erreichen des Kraterrandes kommentieren werde. Das ist unterhaltsam und macht deutlich bessere Laune. Von Anfang an haben wir das Tempo und strahlen wahrscheinlich auch die Lethargie einer Gruppe Leprakranker aus. Über die Stunden wirkt sich dies auch auf die Gemütsverfassung aus. Der nichtendenwollende, sehr, sehr langsame Marsch sorgt in einer Form von Selbsthypnose dafür, daß wir im Nachhinein unisono feststellen, daß wir offensichtlich jeder zwischendurch mal eine halbe Stunde geschlafen haben müssen. Jedenfalls verlieren wir jedes Gefühl für die Zeit. Die Blicke nach Oben spare ich mir schließlich auch fast völlig, da tut sich nichts, demotiviert eher. Wegen der Kälte und um uns nicht zu enttäuschen, schauen wir auch kaum auf die Uhren. Wozu auch ?
Irgendwann beginnt sich jedoch der Schattenriß vor uns mit jedem Schritt zu verändern. Überraschender Weise sind es auf einmal nur noch wenige Meter und plötzlich erreichen wir um 5:50 den fast waagerechten Rand des Kraters.
Hier erwartet uns auf 5756 m der „Stella-
Wer es bis hierher geschafft hat, gilt bereits als Kilimanjaro-
Ein ganz besonderer, unvergesslicher Moment.
Und irgendwie eine Fügung, daß sich das alles gerade im 160. Jahr unserer verehrlichen Burschenschaft Rugia ergibt.
Bereits am Abend vorher hatten wir mit Wilson unsere Positionen ausgetauscht, wie lange wir „Oben“ bleiben dürfen. Da es uns überragend gut geht, weit besser als erwartet, sind wir erstmal nicht wegzubewegen.
Das hatten wir ihm für diesen Fall angekündigt.
So oft kommen wir hier ja nicht hierher. Und die Aussicht ist grandios ! Der Wind reißt mit mindestens Windstärke 8 an uns und es sind wohl fast 20 Grad Minus. Die Finger scheinen beim Fotografieren innerhalb von wenigen Sekunden durchzufrieren. Nach etwa 30min wird das Drängen unserer beiden Guides langsam panisch. Na gut, auch die Profis können mal die Höhenkrankheit bekommen, fällt uns reichlich spät ein. Schweren Herzens lassen wir uns dazu bewegen den Rückweg anzutreten. Immer noch strömen Gruppen von Menschen an uns vorbei. Viele sind auf den anderen Routen gekommen, aber hier muß eben jeder entlang.
Die erste Euphorie unseres Gipfelsturms können wir leider nur noch bis zum Stella-
Das vorgelegte Tempo erfordert in großen Schotterflächen stehend hinabzugleiten, als hätte man Skier an. Nicht ganz meine Sache. Aber es ist der große Moment für die Gamaschen, die verhindern, daß dabei kleine Steinchen von oben in die Schuhe rutschen. Das alles fordert maximale Konzentration und Kraft bis wir gegen 10:00 in der grellen Sonne durchgeschwitzt und mit zitternden Knien endlich das Lager sehen.
An seinem Rande erwartet uns schon einer der Porter und nimmt uns die Rucksäcke ab.
Inwischen sind wir so weich gekocht, daß wir es dankbar annehmen.
Nach einstündigem, ununterbrochenem, tiefen Schlaf und einer großer Mahlzeit füllen wir wieder unsere Packsäcke. Gegen 12:00 geht es weiter im Schnellschritt bergab und wir erleben noch einmal alle Vegetationszonen im Schnelldurchlauf. Am Ende kommen wir am späten Nachmittag, seit 7:45 den Berg fast 3000 Höhenmeter hinabgehastet, an einer unübersehbar großen, lichten Stelle des Waldes an: Mweka Hut, auf 3100m die letzte Übernachtungsstation in der sich die Bergbezwinger aller Routen treffen. Es ist das mit Abstand größte und unübersichtlichste Camp unserer Reise. Aber Toiletten und Versorgung lassen endlich wieder die Nähe der Zivilisation erahnen.
Fast jeden Tag haben wir über die Verteilung der üblichen Trinkgelder an das Team gesprochen, hatten von Zuhause extra Dollars in kleinen Scheinen mitgenommen. Ein Thema welches uns mindestens genau so verunsichert, wie die Besteigung selbst. Es gibt Richtwerte innerhalb derer man sich bewegen sollte, um den Frieden innerhalb des Teams und zwischen den Teams zu bewahren. Für uns gibt es keinen Grund weniger als die empfohlene Obergrenze vorzubereiten. Und völlig vom typisch deutschen Willen alles richtig zu machen beseelt, wählen wir auf Anraten unseres Guides den ganz korrekten Weg: die Übergabe der Trinkgelder in einer kleinen Zeremonie zwischen den Zelten. „So ist am Besten.“ Ein großer Kreis, Gesang der Mannschaft, Dankesreden beider Seiten, Verteilung des abgezählten Geldes in separaten Briefumschlägen mit ein paar englisch hingeholperten Dankesworten, inklusive Umarmung und Schulterklopfen, an jeden Einzelnen und nochmal Singen. Im ersten Moment etwas peinlich. So viel Aufhebens ! Aber eine wichtige Form der Würdigung und des gegenseitigen Wahrnehmens, denn mit den Portern hatten wir nur wenig zu tun, hatten sie im steten, täglichen Fluß der vorbeihastenden Gepäckträger kaum von denen anderer Gruppen unterscheiden können. Wir geben ihnen all die Herzlichkeit dieses Moments und werden mit einer Dankbarkeit belohnt, die über die finanziell bedingte weit hinausgeht.
Tag 7. Der letzte Tag beginnt mit dem Abstieg zum Mweka Gate (1640m), dem Ausgang des Kilimanjaro-
Der einzige „Körperschaden“, der mich allerdings noch fast exakt ein halbes Jahr begleiten wird, ist ein Bluterguß in einem großen Zeh. Beim Hinabmarschieren rutscht man automatisch weit nach vorn in den Schuh und ich bin mehrere Stunden mit nicht fest gebundenen Schuhwerk unterwegs gewesen -
Gegen 11:00 tragen wir uns in dem obligatorischen Besucherbuch ein, das an allen Stationen ausliegt bzw. in diesem Fall aus. Ausserdem gibt es die heilige Urkunde, die die Besteigung des Uhuru Peaks bestätigt.
Wir nehmen großartige, unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause, sind auf der einen Seite sehr stolz darauf, es geschafft zu haben, spüren die Belastung noch in den Knochen und fragen uns doch schon, ob wir das noch einmal machen wollen. Die anderen Routen bieten weitere reizvolle Aspekte.
Was bleibt:
Meine Einstellung zu sportlichen Herausforderungen hat sich grundsätzlich geändert (Das wurde auch höchste Zeit !)
Neue Herausforderungen locken: Im Sommer war ich mit Volkmar im Elbsandsteingebirge Kettern, richtig Klettern.
Jens und Inez haben im selben Jahr in Peru noch zwei 6000er bestiegen.
Von den 10min Extrem-
Wenn ich ein Tief habe, dann reicht es mir die Bilder dieser Reise anzuschauen. Eigentlich reicht es schon daran zu denken -
Reisen ist ein guter Weg Geld auszugeben und doch reicher zu werden.
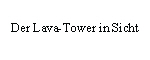
| NetzpolitikOrg |
| KAusbeutung |
| Kilimanjaro |